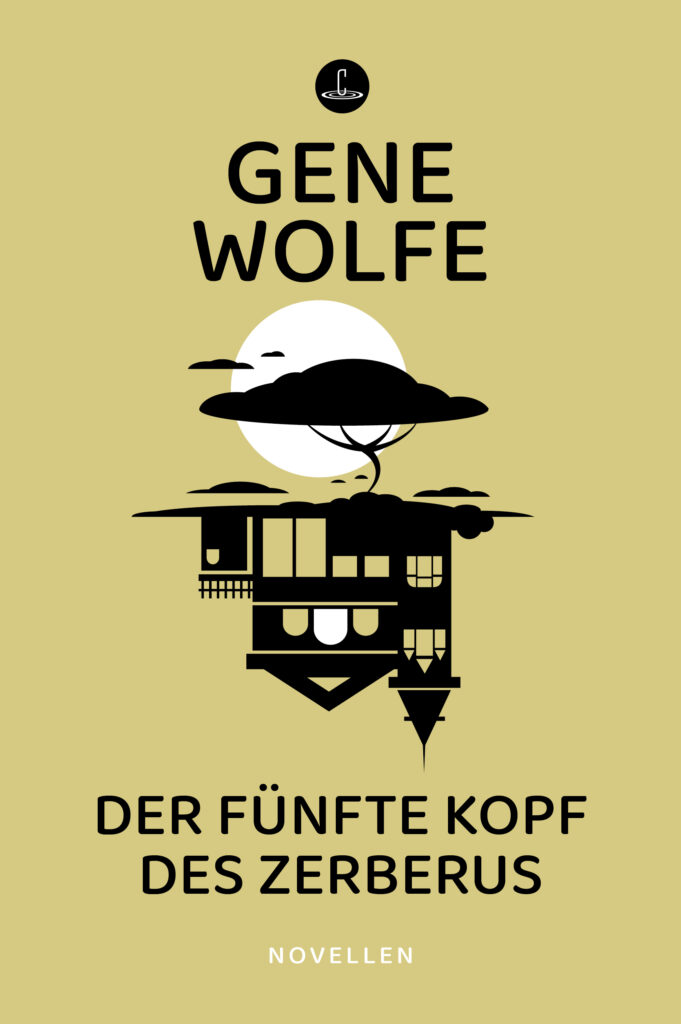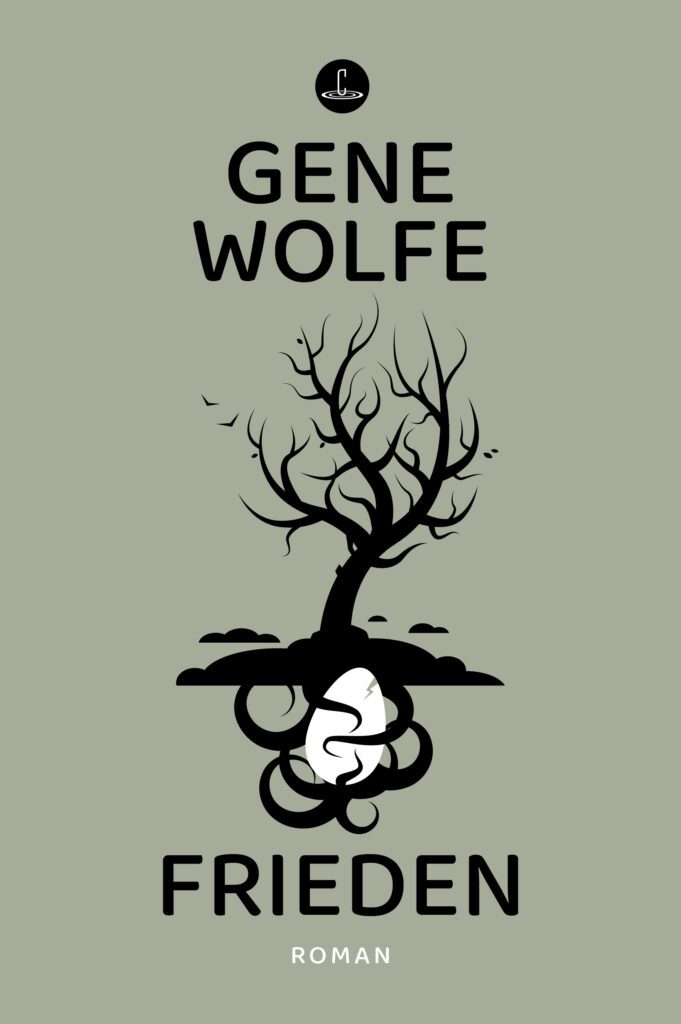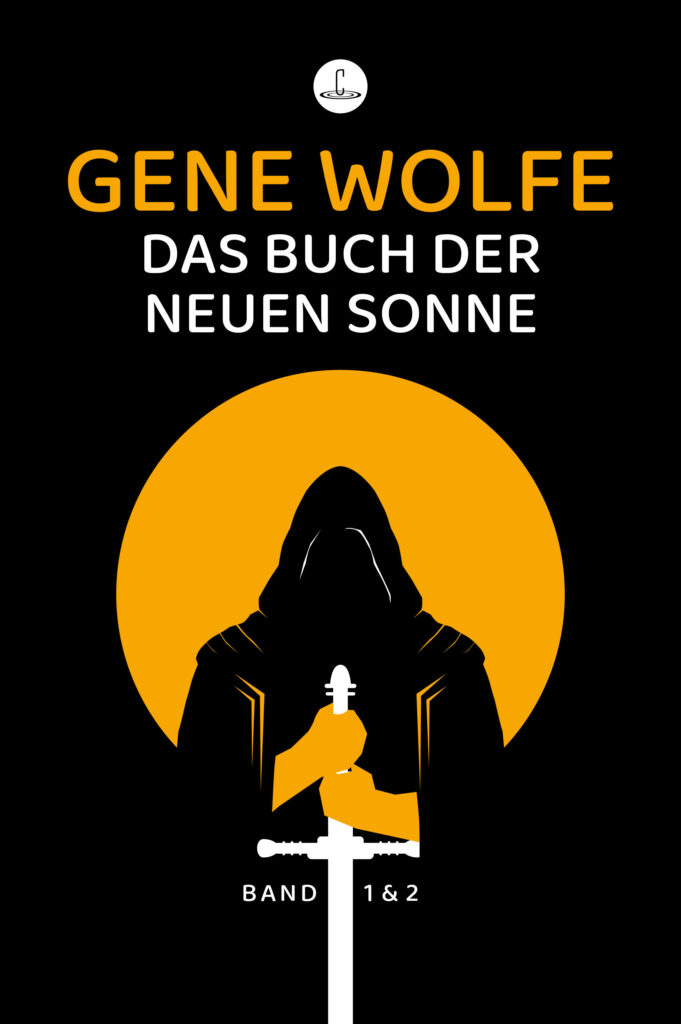Artikel aus der Science Fiction Encyclopedia
Deutsch von Hannes Riffel
Link zum Original: Gene Wolfe
(1931–2019) US-amerikanischer Schriftsteller, geboren in New York, aufgewachsen in Texas, lange Zeit ansässig in Illinois. Er diente in Korea und machte dort Erfahrungen, die über Jahrzehnte hinweg seine Schilderungen von Kriegen maßgeblich geprägt haben; vieles davon findet sich in der Korrespondenz mit seiner Mutter aus den Jahren 1952 bis 1954 wieder, die in Letters Home (1991) gesammelt vorliegt. Er machte einen Abschluss als Maschinenbauingenieur an der University of Houston und arbeitete in diesem Fach, bis er 1972 Herausgeber der Fachzeitschrift Plant Engineering wurde. Nachdem er 1984 aus dieser Position ausschied, schrieb er hauptberuflich. Obwohl er bei der Leserschaft weder zur Spitze in Sachen Beliebtheit zählte noch zu jenen, die in der literarischen Szene über großen Einfluss verfügten, ist Wolfe sehr wahrscheinlich bis heute der bedeutendste Schriftsteller, den die SF hervorgebracht hat, und zwar sowohl hinsichtlich des schriftstellerischen Niveaus als auch aufgrund der Anzahl hochkarätiger Werke, die er ab 1965 hervorgebracht hat. Von diesem Zeitpunkt an hat Wolfe bis etwa 2010 Texte geschrieben, die auf beispielhafte Weise Modernismus und Genre-SF in sich vereinigten. Letztlich ist er für die Weltliteratur und die Phantastik gleichermaßen von so großer Bedeutung, weil es ihm gelang, diese vorgeblichen Gegensätze literarisch aufzulösen.
Wolfes Werk erweist sich als modern im eigentlichen Sinne dieses Begriffs: Es ist gleichzeitig sowohl gegenwärtig als auch weltabgewandt; und obwohl es die Welt als etwas darstellt, das furchtbar schwer in Worte zu fassen ist, hält Wolfe doch an einer elementar modernen Prämisse fest, nämlich der, dass es eine darstellbare Welt gibt, wie schwierig sie auch zu beschreiben sein mag. Diese Überzeugung dient ihm als plausible Erklärung dafür, seinen düsteren Katholizismus kreativ zu entfalten. Das Gleichgewicht zum Megatext der SF wird niemals gestört; jedes Wort ist geprägt von einer Ehrfurcht gegenüber dem, was innerhalb des Rahmens der Phantastik formuliert werden kann. Das Ergebnis besteht in einer bedrückenden »Stille«, nämlich einem tiefen auktoriales Schweigen darüber, was eine Erzählung vielleicht bedeuten mag. Nur die Geschichte selbst spricht; Wolfe spricht nie.
Bedauerlicherweise wirkt sein Werk aufgrund der anspruchsvollen Haltung, die den interpretativen Zugang bisweilen einschränkt, für die gegenwärtige und stark vereinfachende akademische Diskurskritik beinahe völlig unverständlich. Da deren Vormachtstellung allmählich schwindet, erscheint es denkbar, dass ein jüngeres Publikum einen eigenen Zugang findet. Andererseits hat Wolfes ausgiebiger Gebrauch von Tropen und Topi der Genre-SF zwangsläufig dazu geführt, dass jegliche Resonanz, die sein Werk innerhalb der mit SF unvertrauten Kritik hatte, äußerst dürftig war. Speziell für feministische Ansätze ist bei ihm nicht viel Raum vorhanden.
Welchen literarischen Einflüssen Wolfe unterlag, ist nur bedingt nachvollziehbar. Wenn er sich mit dem Werk von Robert A. Heinlein beschäftigt, scheint dies mehr Hommage zu sein als Kritik, zumal Wolfe mit Jorge Luis Borges (zweifellos ein Einfluss) eine Vorliebe für Autoren wie G. K. Chesterton und Rudyard Kipling teilt. Diese drei Autoren ausgenommen, stammen seine Anleihen weitgehend aus der US-amerikanischen Science Fiction. Hier ist speziell der Einfluss von Jack Vance festzustellen, dessen Kurzgeschichtensammlung The Dying Earth (1959 <Die sterbende Erde [München: Heyne, 1978]>, dt. von Lore Strassl) offensichtlich dazu beigetragen hat, den Hintergrund von Wolfes Meisterwerk The Book of the News Sun auszugestalten. Dabei werden einige der bisweilen entlegenen Themen der »Scientific Romance« ebenfalls berücksichtigt; aber Wolfes rückbezügliche Komplexität ist weit entfernt von dem zappeligen Unbehagen mit dem Erzählbaren, das für die »Scientific Romance« typisch ist. Als Ausnahme kann H. G. Wells gelten, dessen Neigung zu reduktiver Klarheit die Kehrseite von Wolfes düsteren Zweifeln an der Wirksamkeit von »Erklärungen« markiert. Eine Erzählung von Wolfe weiß immer mehr, als sie verrät, und erschließt sich so gut wie nie bei der ersten Lektüre. Ursula K. Le Guins oft zitiertes Lob – »Wolfe ist unser Melville« – lässt sich als Hinweis darauf verstehen, dass beide Autoren eine enorme Wissensbegierde und Auffassungsgabe gemeinsam haben, wofür Wolfes The Book of the News Sun und Herman Melvilles Moby Dick (1851) die wohl besten Beispiele sind. Darüber hinaus sei festgestellt, dass bislang vermutlich kein anderer US-amerikanischer Autor den auktorialen Kunstgriff, der den Kern von Melvilles spätem Meisterwerk The Confidence Man: His Masquerade (1857) ausmacht, auf einem solchen Niveau erfasst hat wie Wolfe in der Darstellung seiner Hauptfiguren. Woraus sich durchaus ableiten lässt, dass Wolfe Melville fortführt.
Wolfe hat früh angefangen zu schreiben, aber seine erste veröffentlichte Geschichte, »The Case of the Vanishing Ghost« (The Commentator [November 1951]), erzielte keinen Durchbruch beim Publikum. Der sollte sich erst mit »The Dead Man« (Sir! [Oktober 1965]) einstellen, nachdem er zuvor jahrelang bemerkenswerte Erzählungen verfasst hatte; diese Texte liegen gesammelt in Young Wolfe: A Collection of Early Stories (2002) vor. In den Folgejahren erschienen Wolfes besten Werke meist in der von Damon Knight herausgegebenen Reihe Orbit, von »Trip, Trap« (Orbit 2 [1967]) bis zu der vorzüglichen kafkaesken Allegorie »Forlesen« (Orbit 14 [1974]).
»The Island of Doctor Death and Other Stories« (Orbit 7 [1970]) wurde zusammen mit »The Death of Doctor Island« (Universe 3 [1973], hrsg. von Terry Carr), »The Doctor of Death Island (Immortal [1978], hrsg. von Jack Dann) und »Death of the Island Doctor« (Erstveröffentlichung ebendort) in The Wolfe Archipelago (1983) publiziert. Diese vier Erzählungen, die jeweils für sich stehen, jedoch die Strukturen und Themen der anderen Texte widerspiegeln, stellen eine Art »kubistisches Porträt« von Identität dar. Das zugrundeliegende ontologische Problem wird mit einer Begrifflichkeit erfasst, das ausdrücklich der SF angehört. Auch wenn nur wenige seiner Werke der Jugendliteratur zuzurechnen sind oder mit dem Gedanken an ein juveniles Publikum geschrieben wurden, werden die Archipelago ‑Texte – wie auch meist seine längeren Geschichten – aus der Sicht von Kindern erzählt, was ihnen eine zutiefst trügerische Aura von Eindeutigkeit verleiht. Obwohl alle Oberflächen bei Wolfe fast immer mit großer Präzision dargestellt werden, wird die eigentliche Geschichte zumeist über Umwege erzählt; sie enthüllt sich primär durch Entschlüsselung und einem Verständnis für die richtige hierarchische Anordnung der Einzelteile. Die Archipelago-Erzählungen nutzen den metaphorisch fruchtbaren Insel-Kontext, dessen sie sich auf vielfältige Weise bedienen. »The Island of Doctor Death and Other Stories« schreitet mit traumwandlerischer Sicherheit die sich verändernden Grenze ab, welche die Phantasie von der Realität trennt – ein kleiner Junge zieht sich aus der rauen Umgebung der Erwachsenen in die eindeutigere Welt zurück, die von einem Pulpmagazin heraufbeschworen wird. »The Death of Doctor Island« erweitert dieses Thema und kehrt es um; es wird die Behandlung eines psychisch kranken Kindes geschildert, das in eine künstliche Umgebung eingesperrt ist, die auf seine geistige Verfassung reagiert. In »The Doctor of Death Island« wird ein kryogenisch eingefrorener Gefangener aufgeweckt und stellt fest, dass seine Isolation durch Unsterblichkeit noch verstärkt worden ist. Alle drei Protagonisten müssen in einem für Wolfe typischen Manöver versuchen, die Geschichten, die ihnen erzählt werden, zu entziffern und zu durchdringen, um sich auf diese Weise (vielleicht) zu befreien. Für »The Death of Doctor Island« wurde Wolfe mit einem Nebula ausgezeichnet.
Während der 1970er Jahre fuhr Wolfe fort, mit beträchtlichem Tempo Erzählungen zu veröffentlichen; bis zum Ende des Jahrzehnts wurden wenigstens siebzig gedruckt. In den 1980er Jahren konzentrierte er sich zunehmend auf Romane, und seine Produktion an Kurzgeschichten ließ spürbar nach; mit dem Beginn der 1990er Jahre nahm sein Ausstoß jedoch wieder zu. Letztendlich hat er über zweihundert Erzählungen veröffentlicht. Sein kürzeren Texte liegen in verschiedenen Sammelbänden vor, angefangen mit The Island of Doctor Death and Other Stories and Other Stories (1980) und Gene Wolfe’s Book of Days (1981 <Das Buch der Feiertage [München: Heyne, 1986], dt. von Irene Bonhorst, Birgit Reß-Bohusch & Biggy Winter>; 1992 erweitert unter dem Titel Castle of Days). Posthum erschien The Best of Gene Wolfe (2023); The Dead Man and Other Horror Stories (2023) enthält einige frühe Erzählungen, aber vor allem solche aus dem 21. Jahrhundert; The Wolfe at the Door (2023) vereinigt Texte, die im Laufe von Wolfes gesamter Karriere entstanden sind.
Zu den Kurzgeschichten und Novellen von besonderem Interesse zählen »Three Million Square Miles« in The Ruins of Earth (1971, hrsg. von Thomas M. Disch), »Feather Tigers« in Edge (Herbst/Winter 1973), »La Befana« in Galaxy (January/Februar 1973), »The Hero as Werwolf« in The New Improved Sun (1975, hrsg. von Thomas M. Disch), »Tracking Song« in In the Wake of Man (1975, hrsg. von Roger Elwood), »The Eyeflash Miracles« in Future Power (1976), hrsg. von Gardner Dozois & Jack Dann), »Seven American Nights« in Orbit 20 (1978, hrsg. von Damon Knight), »War Beneath the Tree« in Omni (Dezember 1979) und »The Detective of Dreams« in Dark Forces (1980, hrsg. von Kirby McCauley). In den 1980ern neigte Wolfe dazu, die kurze Form auf das Verfassen traumartiger Gedankenspiele zu beschränken. Zu den interessanteren Geschichten ab 1990 gehören »The Ziggurat« in Full Spectrum 5 (1995, hrsg. von Tom Dupree, Jennifer Hersh & Janna Silverstein), eine komplexe Meditation über Aliens und Entfremdung, sowie »Memorare« in Fantasy and SF (April 2007), eine medienkritische Novelle, die an Begräbnisgedenkstätten spielt, die über das ganze Sonnensystem verteilt sind. In dieser späten Prosa ist ein spezifisch US-amerikanischer Einfluss zu erkennen, nämlich der von Algis Budrys. Er ist im Hinblick auf die »Tiefenstruktur« von Erzählungen möglicherweise Wolfes bedeutendster Vorläufer; beide Autoren schufen labyrinthische Werke, die zu betreten inhaltlich für Protagonisten und in ästhetischer Hinsicht für Leser:innen gleichermaßen riskant ist.
Wolfes erster Roman, Operation ARES (1970 <Unternehmen Ares [Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, 1971], dt. von Sven Illgen>), in dem die USA im 21. Jahrhundert dem technologischen Fortschritt den Rücken gekehrt haben und von ihrer aufgegebenen Mars kolonie infiltriert werden, wurde vom Verlag stark gekürzt und liest sich wie ein Gesellenstück. Trotzdem ist es typisch für Wolfe, insofern der Protagonist – nachdem er so getan hat, als gehöre er der pro-marsianischen Untergrundbewegung ARES an – widerwillig zu ihrem tatsächlichen Anführer wird. Der nächste Roman, The Fifth Head of Cerberus (1972 <Der fünfte Kopf des Zerberus [Wittenberge: Carcosa, 2023], dt. von Hannes Riffel>), besteht aus drei längeren Erzählungen, wobei die Titelgeschichte bereits in Orbit 10 (1972) veröffentlicht wurde. Das Buch lässt sich als ein Mosaikroman bezeichnen. Es spielt auf den zwei Planeten eines fernen Sonnensystems, wo sich Siedler französischen Ursprungs niedergelassen haben, und verbindet Aliens, Anthropologie, Klone und andere Elemente in einer äußerst einfallsreichen Erkundung von Identität und Individualität. Hier wird zum ersten Mal in aller Deutlichkeit vorgeführt, wie schwierig es ist, Wolfe zu lesen, ohne fortwährend auf die subtilen – aber ausnahmslos maßgeblichen – Hinweise zu achten, die im Text verstreut und verständnisleitend sind. Wie in allen seinen bedeutenden Werken erzählt der Protagonist (in diesem Fall gibt es noch einen zweiten) die Geschichte seiner Kindheit. Dies tut er aus konzeptionellen Gründen in der ersten Person; eine Formalisierung der Beichtform, deren Wert unerbittlich infrage gestellt wird und deren Erkenntnisse beinahe ausnahmslos verschleiert werden. Die Elternschaft des Klons, der den ersten Teil erzählt, ist, wie in Wolfes Werken üblich, problematisch – oder wird verheimlicht; die Identitätsfrage nimmt an schmerzhafter Intensität zu, als klar wird, dass ein Gestaltwandler (nämlich der zweite Protagonist) von einem anderen Planeten die Identität eines Anthropologen angenommen hat. Am Ende des Romans verkörpern beide Protagonisten – einer ein Klon, der gentechnisch so manipuliert wurde, dass er vorhergehende Identitäten wiederholt, der andere ein Hochstapler, der nicht nur im Sarg seines fingierten Ichs gefangen ist, sondern tatsächlich im Gefängnis sitzt – eine überaus vielschichtige und düstere Vision davon, auf welche Weise Bewusstsein im Lauf der Zeit geformt wird. Wie in den besten Werken Wolfes sind auch hier alle Gesichter Masken.
Peace (1975 <Frieden [Wittenberge: Carcosa, 2025], dt. von Hannes Riffel>), ein im Mittleren Westen der USA spielender phantastischer Roman, ist vielleicht Wolfes komplexestes und persönlichstes Werk. Obwohl es sich nicht um Science Fiction handelt, ist Peace von zentraler Bedeutung, um die anderen Romane des Autors umfassend zu verstehen. Es geht um den Sinn für die große Schmerzlichkeit jeden Lebens und um den (in diesem Fall) enormen Preis eines Daseins, das so unzureichend gestaltet ist, dass es nicht ehrlich erzählt werden kann, selbst wenn es darum geht, eine Seele zu retten. Der Protagonist des Buches – der die Geschichte seiner Kindheit und seines frühen Mannesalters, ohne sich dessen bewusst zu sein, von jenseits des Grabes erzählt –, transportiert ein Selbstporträt, das den Künstler zugleich als Geschichtenerzähler und brutalen Mörder zeigt.
The Devil in the Forest (1976 <Der Teufel hinter den Wäldern [Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, 1980], dt. von Thomas Ziegler>) ist ein Jugendbuch, das zur Zeit von König Wenzeslaus spielt und kaum phantastische Elemente enthält, aber in seiner stilistischen Leichtigkeit einiges mit Pandora by Holly Hollander (1990) gemeinsam hat; möglicherweise sind beide Romane zur selben Zeit entstanden. Danach konzentrierte sich Wolfe auf mehrbändige Romane und Serien, was er bis zu seinem Lebensende beibehalten sollte.
Wolfes nächstes Werk ist sein ehrgeizigstes – die Bücher der Sonne umfassen drei mehrbändige Romane sowie weitere Texte. Die Arbeit daran nahm den Großteil der Jahre zwischen 1980 und 2000 in Anspruch, und das Ergebnis machte ihn schließlich einem größeren Publikum bekannt. Jeder dieser Romane ist als Manuskript gestaltet, das vom Protagonisten der Geschichte (oder von einer Figur, die in einer engen Beziehung zu diesem steht) niedergeschrieben wurde; die Struktur ist die eines unzuverlässigen rekursiven Rückblicks, wie in fast allen von Wolfes umfangreichen Texten. Der erste (und am höchsten geschätzte) Teil dieses Projekts ist The Book of the New Sun, eigentlich ein einziger durchgehender Roman, der aus kommerziellen Gründen in vier Bände aufgeteilt wurde: The Shadow of the Torturer (1980 <Der Schatten des Folterers [München: Heyne, 1984], dt. von Reinhard Heinz>), The Claw of the Conciliator (1981 <Die Klaue des Schlichters [München: Heyne, 1984], dt. von Reinhard Heinz>), The Sword of the Lictor (1982 <Das Schwert des Liktors [München: Heyne, 1984], dt. von Reinhard Heinz>) und The Citadel of the Autarch (1983 <Die Zitadelle des Autarchen [München: Heyne, 1984], dt. von Reinhard Heinz>). Die ersten beiden Bände liegen gesammelt als Shadow and Claw (1994 <Das Buch der neuen Sonne 1& 2 [Wittenberge: Carcosa, 2026]; dt. von Reinhard Heinz [überarbeitet]) vor, Band 3 und 4 als Sword and Citadel (1994 <Das Buch der neuen Sonne 3 & 4 [Wittenberge: Carcosa, 2026]; dt. von Reinhard Heinz [überarbeitet]). Der ganze Roman wurde schließlich in einem Band unter dem Titel Severian of the Guild (2007) veröffentlicht. The Castle of the Otter (1983) enthält Essays und Erzählungen, die The Book of the New Sun kommentierend erklären. Geschichten, die angeblich dem titelgebenden Buch entnommen wurden, das Severian auf seinen Reisen bei sich trägt, erschienen als »The Boy Who Hooked the Sun: A Tale from the Book of Wonders of Urth and Sky« (1985) und »Empires of Foliage and Flower: A Tale from the Book of Wonders of Urth and Sky« (1987); »A Solar Labyrinth« in Fantasy and SF (April 1983) ist ein metafiktionaler Text über das ganze Book. The Shadow of the Torturer wurde mit einem World Fantasy Award
ausgezeichnet und The Claw of the Conciliator mit einem Nebula.
Als ein auf den Schultern von Riesen stehendes Erzählwerk – solche Arbeiten erscheinen aus naheliegenden Gründen erst in der Spätphase des Genres, das sie transformieren – geht The Book of the New Sun grundsätzlich auf viele SF- und Fantasy-Elemente zurück; darüber hinaus ergibt sich ein besonderer Bezug zu »Die sterbende Erde« von Jack Vance (siehe auch »Ferne Zukunft«) und die Subkategorie der »Planetary Romance«. The Book of the New Sun spielt – Äonen in der Zukunft – auf Urth, einer Welt, die von den menschlichen Relikten in einem solchen Maße beeinflusst wurde, dass Archäologie und Geologie zu einer Wissenschaft verschmolzen sind. Der Planet wird nach Botschaften abgesucht, die während unzähliger Jahre unentwirrbar miteinander vermischt wurden. Die Welt, in die Severian hineingeboren wird, erstickt tatsächlich so sehr unter Formeln und Ritualen, dass The Shadow of the Torturer zunächst der Fantasy-Kategorie Schwert und Magie zugerechnet wurde, obwohl es – wie üblich bei Wolfe – genügend Hinweise gibt, dass sich das Buch mit den Begriffen der Science Fiction erklären lässt. Severian ist offenbar ein Waise, der als Foltererlehrling vom Orden der Wahrheitssucher und Büßer erzogen wird, und zwar in seiner angestammten Wohnstätte, dem Matchin-Turm, der auf dem Anwesen der Zitadelle in der Hauptstadt Nessus zwischen ähnlichen Gebäuden steht. (Eines der leichter zu lösenden Rätsel, die Wolfe uns stellt, dreht sich darum, dass es sich bei den Türmen in Wirklichkeit um uralte Raumschiffe handelt). Severian wächst zu einem jungen Erwachsenen heran und pflegt schließlich zu intimen Umgang mit der gefangenen Thecla, einer genmanipulierten Aristokratin, die dem Tod geweiht ist. Er wird verbannt, bereist das Land und wird hoch im Norden in einen Krieg verwickelt, wobei er den alten Autarchen – den Schlichter — trifft, der die Welt beherrscht und erkennt, dass Severian sein Nachfolger werden soll. Entsprechend nimmt Severian dessen Gedächtnis (das die Erinnerungen aller bisherigen Autarchen umfasst) in sich auf, wie er zuvor schon bei Thecla gemacht hat. Dann wird er selbst zum Autarchen und verkündet in einem denkwürdigen Schluss seine Absicht, eine »neue Sonne« mit sich bringen zu wollen.
Die Handlung folgt einem klassischen Muster und ist, oberflächlich betrachtet, unproblematisch. Doch von der Anlage her unterscheidet sich Severian grundlegend von den üblichen Helden der SF oder der Science-Fantasy, denen er manchmal zu ähneln scheint. Er erzählt die Geschichte seiner Kindheit und frühen Jugend mit einigem zeitlichen Abstand in einem täuschend abgeklärten Tonfall und behauptet, über ein unfehlbares Gedächtnis zu verfügen (was nicht bedeutet, dass er immer unfehlbar die Wahrheit sagt); er macht ebenfalls deutlich, dass er von einem sehr frühen Alter an wusste, dass er die wiedergeborene Fleischwerdung des Schlichters ist (oder war oder sein wird). Letztlich handelt es sich bei ihm um eine Messias ‑Gestalt aus einer früheren oder – aufgrund eines Zeitparadoxons – aus einer parallelen Wirklichkeit, dessen Wiedergeburt ein Vorzeichen bzw. die Ursache dafür ist, dass die Neue Sonne nach Urth gebracht wird. An diesem Punkt fallen SF und Katholizismus zusammen, denn die Neue Sonne ist gleichzeitig materiespendendes Weißes Loch und Offenbarung. Bildsprache und Struktur von Das Buch der Neuen Sonne lassen keinen Zweifel daran, dass Severian selbst Aspekte sowohl von Apollo wie von Christus in sich vereinigt und dass die Geschichte seines Leben eine säkulare Übertragung der Parusie ist, eine Wiederkunft des Herrn. Die Grausamkeit, mit der er sich selbst und andere behandelt, ist die Grausamkeit des Universums an sich; und seine Ehrfurcht vor der Welt stellt keine einfache Gnade dar. Seine Familie ist eine Heilige Familie, dem Anschein nach ärmlich und anonym, aber allgegenwärtig; auch die Tatsache, dass sie nie eine »Hauptrolle« spielt, bringt ebenso religiöse wie ästhetische Implikationen mit sich.
In der Fortsetzung, The Urth of the New Sun (1987 <Die Urth der neuen Sonne [München: Heyne, 1990], dt. von Reinhard Heinz>), durchläuft Severian mehrere Realitätsebenen des Universums bis zu dem Punkt, an dem entschieden ist, ob er als Autarch die Eignung besitzt, die Neue Sonne heimzuführen. Nachdem er inzwischen mehr als einmal gestorben ist, hat er sich zu einem Schatten entwickelt, der in einer Wesenheit lebt; er ist beides: menschlich und posthuman. Diese Kreatur besteht, wie vorherbestimmt, die Prüfung. Urth versinkt in den Fluten, die das Weiße Loch ankündigen, die Wiedergeburt des Lichts. Einige überleben, um von vorne anzufangen; oder um so weiterzumachen wie bisher.
Die zweite Romanfolge, The Book of the Long Sun – bestehend aus Nightside the Long Sun
(1993 <Die Nachtseite der langen Sonne [München: Heyne, 1998], dt. von Jürgen Langowski>) und Lake of the Long Sun (1994 <Der See der langen Sonne [München: Heyne, 1998], dt. von Jürgen Langowski>), als Sammelband unter dem Titel Litany of the Long Sun (1994), sowie Caldé of the Long Sun (1994 <Der Calde der langen Sonne [München: Heyne, 1998]) und Exodus from the Long Sun (1996 <Der Exodus aus der langen Sonne [München: Heyne, 1998], dt. von Jürgen Langowski>), als Sammelband unter dem Titel Epiphany of the Long Sun (1997) –, spielt einige tausend Jahre früher, scheint aber den gleichen mythischen Ursprung zu haben wie The Book of the New Sun. Es handelt sich ebenfalls um eine einzige längere Erzählung, die dieses Mal von einem Schüler des Protagonisten niedergeschrieben wurde, und die wie sein Vorgänger dechiffriert werden muss. Die Handlung spielt ausschließlich an Bord eines Generationenraumschiffs , ein in sich geschlossenes Universum, das »Whorl« genannt wird. Der Protagonist, Patera Silk, wird nach und nach zu einer der Hauptfiguren im Kampf um das Schicksal der untergehenden Kultur an Bord des Schiffes. Dazu gehört, dass ihm auf den ersten Seiten der Geschichte eine Erleuchtung widerfährt: Seinem Gehirn wird eine überwältigende Informationsflut aus Erinnerungen eingeschrieben, und zwar von einem Gott oder einer KI, die der Avatar irgendeiner Figur von Urth zu sein scheint und vielleicht jemand ist, der von der Ankunft Christi kündet. Schlussendlich stellt sich heraus, dass die Whorl ihr Ziel erreicht hat: ein System aus zwei Planeten, dem hauptsächlichen Schauplatz von The Book of the Short Sun; und dass die Beeinträchtigungen des Lebens an Bord der Whorl von geheimen Herrschern in Gestalt eines Götterpantheons verursacht wurden, bei denen es sich aber auch um KIs handeln könnte. Ebenso wird deutlich, dass Silk eine Moses-Gestalt repräsentiert: Ihm ist es bestimmt, seinem wandernden Volk den Weg ins Gelobte Land zu weisen, das er selbst nie betreten wird.
Der letzte Roman schließlich, The Book of the Short Sun – bestehend aus On Blue’s Waters (1999), In Green’s Jungles (2000) und Return to the Whorl (2001), als Sammelband unter dem Titel The Book of the Short Sun (2001) –, dürfte unter Wolfes längeren Werken vielleicht am schwersten zu verstehen sein. Das Manuskript, aus dem es besteht, ist so etwas wie eine Fortsetzung der Lebensgeschichte, die der Schüler Horn über seinen Herrn Patera Silk schreibt. Dieser taucht offenbar erst im letzten Band auf, auch wenn es Silk ist oder eine Inkarnation von Horn und Silk, von der die Geschichte letztlich niedergeschrieben wird.
Nachdem Horn gebeten wurde, auf die Whorl zurückzukehren und zu versuchen, Silk zu überzeugen, seinen notleidenden Siedlern einen Besuch abzustatten und sie vor einer fatalen Zwistigkeit zu bewahren, unternimmt er so etwas wie eine fantastische Reise über die Planeten Blau und Grün, besucht verschiedene Städte und Gesellschaften, manche davon Utopien, andere Dystopien, und befreit Silk (oder sich selbst) von der buchstäblichen Blindheit, die den abschließenden Band bestimmt. Inzwischen bestätigt sich im Rahmen einer Zeitdilatation die Möglichkeit, dass sich alle drei Großwerke zur selben Zeit zutragen. Tatsächlich reist Horn/Silk zurück nach Urth und besucht den jungen Severian, der erklärt, Horn/Silk seien so außergewöhnlich, dass er sie in seiner Beichte, aus der das erste der drei Großwerke besteht, nicht einmal erwähnen kann. Schließlich begibt sich Silk (vielleicht erstmals ganz er selbst) in den interstellaren Raum hinaus, wo er – in einem Schluss , der jenen widerspiegelt und verstärkt, mit dem The Book of the New Sun abschließt – im Rahmen einer Christusanalogie nach Menschen fischen wird.
Wolfes Romane der 1980er und 1990er Jahre sind vielfältig und größtenteils der Fantasy zuzurechnen. Free Live Free (1984 <Frees Vermächtnis [München: Heyne, 1995], dt. von Jürgen Langowski>) ist eine komplexe Zeitreisegeschichte, die sich nur schwer zusammenfassen lässt und hinter der sich eine Neuerzählung von L. Frank Baums The Wonderful Wizard of Oz (1900) verbirgt. There Are Doors (1990) spielt in einer Parallelwelt, die stark an die USA während der Großen Depression erinnert, und schildert auf äußerst ambivalente Weise die lebensbedrohliche exogame Leidenschaft eines Mannes für eine Göttin. Castleview (1990) verpflanzt die Artussage fast vollständig nach Illinois, wo ein neuer Arthur für den langen Kampf rekrutiert wird.
Interessanter ist vielleicht die Latro-Serie, bestehend aus Soldier of the Mist (1986 <Soldat des Nebels [München: Heyne, 1989], dt. von Jürgen Langowski>), Soldier of Arete (1989) und Soldier of Sidon (2006). Schauplätze sind Griechenland und Nordafrika etwa fünfhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung; erzählt wird in kurzen Kapiteln, die jeweils aus den Erinnerungen an einen einzigen Tag bestehen. Hauptfigur ist Latro, ein Soldat, den eine Göttin oder irgendein anderes Geschöpf bestraft hat: Er kann sich an nichts erinnern, was länger als vierundzwanzig Stunden zurückliegt, sodass jedes Geständnis, das er sich vornimmt, nie dazu führen wird, dass er aus der Gefangenschaft entlassen wird. Entsprechend fungiert die Serie, auf jeder möglichen Ebene, als Spiegelbild von The Book of the New Sun, wobei Latros Erinnerungsverlust die Kehrseite zu Severian darstellt, der nicht vergessen kann. Das antike Griechenland wiederum ist die Kehrseite von Urth – als Anfang von etwas, und nicht als Ende –, und das offene Ende der Serie bildet das Gegenteil jener Erzählstruktur, die unaufhaltsam auf Severians Kommen zuführt. The Wizard (2004 <Der Zauberer [Stuttgart: Klett-Cotta, 2006], dt. von Jürgen Langowski>) und The Knight (2004 <Der Ritter [Stuttgart: Klett-Cotta, 2006], dt. von Jürgen Langowski>) – als Sammelband The Wizard Knight (2005) – sind wieder Fantasy und spielen in einem System sphärischer Welten, die einander wie Matroschkas umschließen, alle auf ontologische wie theologische Weise gottgewollt; auch hier taucht eine Artus-Gestalt auf.
Zwei spätere Romane sind in sich abgeschlossen. Pirate Freedom (2007) erzählt von einem plötzlichen Bruch innerhalb der Zeit; ein Priester in einer Alternativwelt , die unserer nahen Zukunft gleicht, schreibt nieder, was er im 17. Jahrhundert als Seeräuber erlebt hat. Wieder handelt es sich um eine Beichte, allerdings um eine recht trotzige. Home Fires (2011) spielt in einer an Energiearmut leidenden, dystopischen nahen Zukunft in den USA und wird aus der Sicht des Ehemanns einer Soldatin erzählt, deren Einsätze auf fernen Planeten, wo sie gegen Außerirdische kämpft, ihre Identität kompromittiert haben. Die hochdramatische Folge von Abenteuern, in denen ihre Versuche dargestellt werden, die eigene Welt zu verstehen, trägt kaum dazu bei, die prophetische Finsternis zu verschleiern, die diesem Spätwerk zugrunde liegt. Die Borrowed Man-Serie schließlich, bestehend aus A Borrowed Man (2015) und Interlibrary Loan (2020), spielt in einem nur noch spärlich besiedelten Nordamerika der nahen Zukunft, wo die Regierung eugenische Prinzipien auf die extrem geschrumpfte Bevölkerung anwendet; der Protagonist, Ern (was »Urn« ausgesprochen wird) A Smithe, ein Klon, der die Persönlichkeit eines schon lange verstorbenen Schriftstellers in sich trägt, ist vor dem Gesetz ein Buch in einer Bibliothek, das ausgeliehen oder an andere Bibliotheken weitergegeben werden kann. Das Spiel mit Tod und Inkarnation kulminiert im zweiten Band, als Smythe erfährt, dass eine frühere Version seiner selbst ermordet wurde; überall gibt es Portale, die thanatropisch oder paradiesisch sind oder beides. Mit beklemmender, nüchterner Stimme bildet die Serie den Abschluss von etwas, mit dem sich Wolfe während seiner ganzen Laufbahn beschäftigt hat: dem auf engsten Raum beschränkten Wechselspiel zwischen dem Medium und der Botschaft, wobei in diesem Fall Medium und Botschaft identisch sind.
Es ist möglich, dass Wolfe nie eine einzige originelle SF-Idee hatte oder nie eine bedeutende, jedenfalls keine von dem Kaliber, wie sie Larry Niven oder Greg Bear hervorgebracht haben. Sein Stellenwert beruht nicht auf dieser Form von Originalität. Wenn wir für einen Moment seinen Umgang mit Sprache beiseitelassen, wie blumig diese auch sein mag, und ebenso seine bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Handlungsstrukturen und die schrittweise Enthüllung einzelner Geschehnisse, dann lässt sich behaupten, dass Wolfes Bedeutung für die Science Fiction in seiner Fähigkeit bestand, generische Modelle und Methoden wie ein Schwamm aufzusaugen und auf hohem Niveau zu transformieren. Wolfes Sprache ist manchmal erkennbar parodistisch, und viele seiner Kurzgeschichten spiegeln möglicherweise absichtlich ältere Vorbilder aus dem gesamten Pantheon der Genre-SF wider; doch die Beziehung zwischen den gegenwärtigen und den vorausgehenden Texten besteht nicht nur in der »Melodie« der Worte selbst. Eine musikalische Analogie ist vielleicht die Barocktechnik der parodistischen Kantate, bei der eine säkulare Komposition mittels ehrfurchtsvoller Verklärung (manches davon untergründig) in ein heiliges Werk verwandelt wird; solche Parodien können, sofern sie von bedeutenden Komponisten stammen, oft erst nach langem Studium entschlüsselt werden. Wolfes Bedeutung ist entsprechend zwiefältig: Wie oben dargelegt, ist sein Werk von allerhöchstem Rang, und er trägt die fiktionalen Welten der SF wie einen vielfarbigen Mantel. Seine besten Erzählungen sind auf eine Weise dicht und polychrom, die erst noch erschlossen werden muss. Ein Anthologie mit Hommagen, Shadows of the New Sun: Stories in Honor of Gene Wolfe (2013, hrsg. von Bill Fawcett & J E Mooney), zeigt zu Genüge, wie weitreichend sein Einfluss auf andere Autor:innen war und ist.
1996 wurde Wolfe für sein Lebeswerk mit einem World Fantasy Award ausgezeichnet; 2007 wurde er in die Science Fiction Hall of Fame aufgenommen und 2012 mit dem SFWA Grand Master Award ein weiteres Mal für sein Lebenswerk geehrt.
© 2011–2025 by SFE Ltd.
Mit freundlicher Genehmigung von
John Clute & David Langford
© der Übersetzung 2025 by Hannes Riffel
Redaktion: Christopher Ecker & Kai U. Jürgens
Für die deutschsprachige Veröffentlichung eingerichtet von Kai U. Jürgens