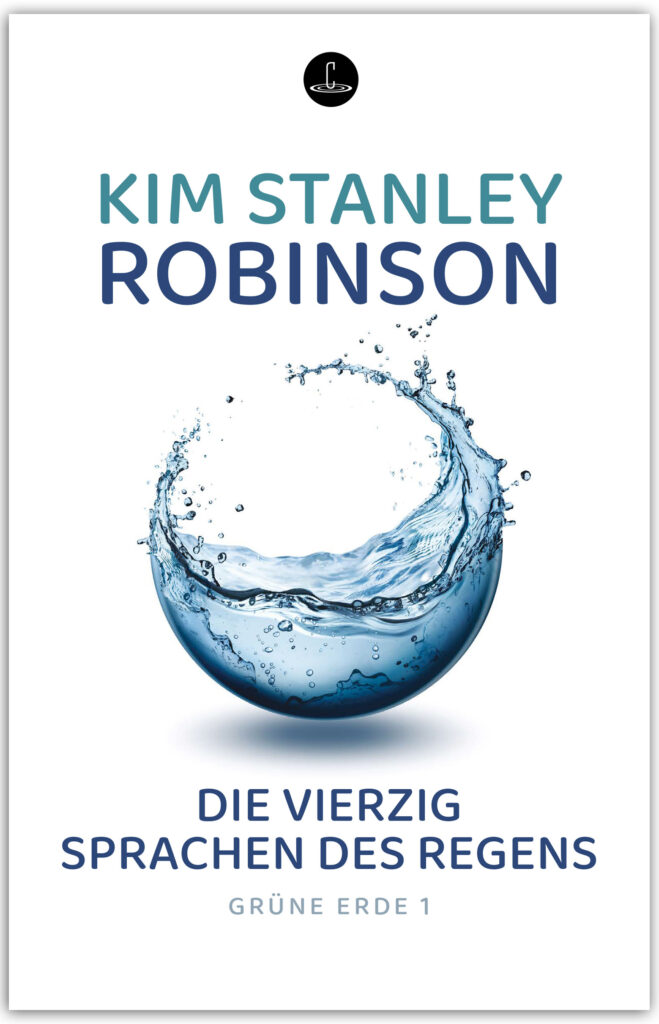von Kim Stanley Robinson
Stellen Sie sich einen Science-Fiction-Roman vor, der vor zwanzig Jahren geschrieben wurde und damals zwanzig Jahre in der Zukunft angesiedelt war. Dann ist das doch ein Roman über die heutige Zeit, oder?
Nein. So funktioniert Science Fiction nicht. Science Fiction sagt nicht die Zukunft voraus, sondern erfindet Szenarien, die aus der Gegenwart abgeleitet sind; außerdem erschafft sie Metaphern dafür, wie wir uns in dieser Gegenwart fühlen. In diesen Metaphern kommen oft Entwicklungsmöglichkeiten zum Ausdruck – Percy Bysshe Shelley hat das einmal den »Schatten der Zukunft« genannt. Wenn man bedenkt, wie sehr sich alle historischen Prozesse seit Beginn der Neuzeit und erst recht seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts beschleunigt haben (Sozialwissenschaftler sprechen mit Blick auf die letzten achtzig Jahre von der »Großen Beschleunigung«), sollten eigentlich alle Roman, die in der »Gegenwart« spielen und wirklich die Atmosphäre der heutigen Zeit einfangen wollen, auch etwas von dieser Beschleunigung vermitteln. Ihre Geschichten sollten stets ein wenig über das Jetzt hinausreichen, denn sie versuchen ein Ziel zu treffen, das sich sehr schnell bewegt.
Deshalb sage ich oft, dass Science Fiction die realistische Literatur unserer Zeit ist. Ich sage das schon seit dem Anfang dieses Jahrhunderts, also ungefähr seit der Zeit, als ich mit der Arbeit an Grüne Erde begonnen habe.
Dieser Roman ist also nach wie vor ein Science-Fiction-Roman über die nahe Zukunft. Zugleich ist er aber auch zu einem historischen Roman geworden, weil er zeigt, wie die Menschen in den Jahren 2002 bis 2006 über ihre Zeit gedacht haben. Und da wir es hier mit relativ kurzen Zeiträumen zu tun haben, kann man ihn ebenso gut als ganz normalen realistischen Roman über die frühen 2000er Jahre betrachten, zu einem Thema, das Anthony Trollope einmal als Titel für einen seiner besten Romane verwendet hat: The Way We Live Now. Wie wir heute leben.
Bei der Gelegenheit sollte ich erwähnen, dass es gar nicht so viele Romane über die Stadt Washington gibt. Dies ist einer der besten, möchte ich behaupten – schon weil mir kaum ein anderer einfällt. Seltsam, aber wahr: Washington ist nicht nur im physikalischen und politischen Sinn ein Sumpf, sondern auch im narrativen. Es erstickt und ertränkt jede Geschichte. Ein Ungeheuer. Kein Wunder, dass Romanautoren die Stadt meiden.
Grüne Erde vereint also mehrere Genres in sich (es ist unter anderem auch ein Spionageroman, ein Liebesroman, ein politischer Roman und ein »Thriller in Zeitlupe«, wie es einmal jemand ausgedrückt hat, obwohl es dieses Genre gar nicht gibt), die alle ihre eigenen Konventionen und ihre eigene Perspektive mitbringen. Beim Lesen überlagert sich das alles und bildet eine Mischung, die auch heute noch interessant ist. Das hoffe ich jedenfalls, denn eine andere denkbare Reaktion wäre: »Also, das hier hat der Autor aber völlig falsch eingeschätzt, und das da auch, und diese und jene Entwicklung hat er überhaupt nicht vorhergesehen« – und so weiter. Alles völlig richtig, und alte Science-Fiction-Geschichten betrachten wir ständig auch unter diesem Blickwinkel, aber Punkte für die Genauigkeit von Vorhersagen zu vergeben, ist wohl die uninteressanteste Herangehensweise an einen Science-Fiction-Roman. Wenn man einen Roman einem bestimmten Genre zuordnet, nimmt man ihn als Teil eines größeren Diskurses wahr, als Variation eines übergeordneten Musters, und das erhöht das Lesevergnügen. Natürlich macht es beim Lesen älterer Science Fiction auch Spaß, die Zeit ihrer Entstehung mit der Zeit zu vergleichen, in der man sie liest, und manchmal gewinnt man gerade dadurch neue Einsichten in historische Abläufe, eine wertvolle Erfahrung. Aber bei allen Romanen geht es im Kern um den Text selbst, und die eigentliche Freude beim Lesen ergibt sich aus den Figuren und der Handlung, mit anderen Worten, aus der Geschichte. Wir alle sind süchtig nach Geschichten, und viele der besten finden sich in Romanen.
Thema dieses Buchs war und ist ein zentrales Problem unserer Gegenwart: die Gefahr eines abrupten Klimawechsels und die Möglichkeit, dass die Menschheit unabsichtlich das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte auslöst, eine Bedrohung für alle Lebewesen und für unsere Zivilisation. In der Zeit seit dem Erscheinen des Romans ist diese Gefahr den meisten von uns bewusst geworden, und wir haben begonnen, etwas dagegen zu unternehmen, aber wir kommen zu langsam voran, weshalb immer öfter auch direkte Eingriffe – manchmal Geo-Engineering genannt – diskutiert werden.
Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, war der Ausdruck »abrupter Klimawechsel« noch ganz neu. Er ist entstanden, als bei der Untersuchung von grönländischen Eisbohrkernen entdeckt wurde, dass sich Grönland und die gesamte Nordhalbkugel zu Beginn der Jüngeren Dryaszeit vor ungefähr 12.000 Jahren innerhalb von nur drei Jahren drastisch abgekühlt haben. Nach geologischem Maßstab ist das nur ein Augenblick, daher das neue Adjektiv »abrupt«. Eine solche Entdeckung verlangte natürlich nach einer Erklärung, und die war bald gefunden: Als die letzte Eiszeit zu Ende ging und die gewaltige Gletscherdecke in der Arktis schrumpfte, ergossen sich die riesigen Mengen an Schmelzwasser in plötzlichen Flutwellen ins Meer. Eine dieser Flutwellen unterbrach den Golfstrom (der inzwischen als Atlantische Umwälzzirkulation – Atlantic Meridional Overturning Circulation oder AMOC – bezeichnet wird), eine Meeresströmung, die riesige Mengen an Wärme aus den Tropen in den Nordatlantik transportiert. Ein Stillstand dieser Strömung führte folglich zu einem plötzlichen Kälteeinbruch zu Beginn der Jüngeren Dryaszeit.
Andere Untersuchungen belegen, dass aufgrund der vom Menschen verursachten Erderwärmung – die durch unseren hohen CO2-Ausstoß verursacht wird und deutlich schneller verläuft als frühere, rein geologische Veränderungen – so große Teile des grönländischen Eisschilds und des arktischen Packeises schmelzen könnten, dass der Golfstrom erneut zum Stillstand kommt und sich das Klima in den nördlichen Breiten rapide abkühlt.
Für dieses Szenario habe ich mich beim Schreiben von Grüne Erde entschieden. Zum einen, weil es sich in einem Zeitrahmen abspielen würde, der sich für einen Roman eignet: Es müsste kein Jahrtausend vergehen, sondern nur ein Jahrzehnt. Außerdem wollte ich mich mit der Frage befassen, wie die Regierung der Vereinigten Staaten auf eine solche globale Veränderung der Lebensbedingungen reagieren könnte. Es sollte also um eine besondere Variante der Probleme gehen, mit denen wir aufgrund des Klimawandels konfrontiert sind. Könnten wir in einer solchen Lage überhaupt etwas unternehmen, und wenn ja, würden wir es tun?
Die Frage, wer den notwendigen politischen Willen und die Handlungsbereitschaft aufbringen würde, ergab sich daraus ganz von selbst. Das wiederum führte geradewegs ins Labyrinth der US-amerikanischen Bundesbehörden sowie zu Fragen der demokratischen Resilienz, also zu Themen wie Wahlbetrug und dem sogenannten »Deep State«, verdeckten Machtstrukturen mitsamt den Machtkämpfen innerhalb der USA oder auch auf internationaler Ebene.
All diese Aspekte spielen bei unserem realen weltweiten Problem ebenfalls eine Rolle. Das ist das übergreifende Thema dieses Buchs; man könnte also einfach sagen: Es handelt von der Geschichte unserer Zeit. Stoff genug für einen langen Roman.
Das Buch ist zwischen 2002 und 2006 in Davis in Kalifornien entstanden, wo ich lange gelebt habe. Etwa zehn Jahre zuvor hatten meine Frau und ich vier Jahre in Washington verbracht, wo meine Frau bei der Food and Drug Administration arbeitete. Davor war sie kurze Zeit bei der Environmental Protection Agency (der Umweltschutzbehörde), danach als Chemikerin im Bereich Wasser und Umwelt beim US Geological Survey. Ich selbst hatte in den 1990er Jahren oft mit der National Science Foundation zu tun, meist im Rahmen des US-amerikanischen Antarktis-Programms.
Vor dem Hintergrund all dieser Erfahrungen hatte ich das Gefühl, dass Washington einen interessanten Romanschauplatz abgeben würde und die Bundesbehörden mir ein ganzes Netzwerk faszinierender Protagonisten liefern konnten. Auch wenn es nicht viele Romane darüber gab, fand ich den Stoff interessant und wichtig. Ganz sicher ließ sich darauf trotz der offensichtlichen Hürden ein spannender Roman aufbauen.
All diese Überlegungen haben schließlich zu meinem dritten und letzten »sehr langen Roman« geführt. Mein Mentor Fredric Jameson hat für diese Werke später den Begriff »Megaromane« geprägt, aber meine Bezeichnung gefällt mir besser. Novellen unterscheiden sich schon aufgrund ihrer Kürze in bestimmten wichtigen formalen Aspekten von Romanen; das gleiche gilt für sehr lange Romane.
»Lang« bedeutet dabei auch »viel«: In Bezug auf meine Mars-Trilogie hat Jameson einmal von »großen Schichten an Stoff« gesprochen, und er zitierte gerne Norman Mailer, der wiederum Thomas Mann zitiert hat, »dass nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei«. Das stimmt zwar nicht, aber natürlich kann man in einem sehr langen Roman eine große Menge an Informationen vermitteln. Das kann dem Text eine »dichte Textur« verleihen und einen starken »Realitätseffekt« erzeugen, sodass der Roman eine wichtige Rolle in der geistigen Welt der Lesenden spielt. Oder um als Romanautor zu sprechen: Ein langer Roman bietet Raum für mehr Figuren, mehr Details bei der Charakterisierung, mehr Geschehnisse und damit auch mehr Handlungsstränge. Das alles kann sich wechselseitig verstärken und sich zu einer übergeordneten Handlung verbinden, die über das Schicksal der einzelnen Figuren hinausgeht und letztlich das Zeitgeschehen als Ganzes abbildet.
Ich habe drei sehr lange Romane verfasst: die Mars-Trilogie, The Years of Rice and Salt und Grüne Erde. Grüne Erde wurde zunächst als Trilogie veröffentlicht; zehn Jahre später schlug ich meiner britischen Lektorin Jane Johnson vor, die drei Teile so weit zu kürzen, dass sie in einem Band erscheinen konnten. Sie war einverstanden und sorgte dafür, dass das Projekt umgesetzt wurde, und auf dieser verdichteten Version basiert die deutsche Übersetzung, die Sie jetzt in der Hand halten. Was mich freut, denn mir ist diese Fassung lieber. Durch die Kürzungen (ich habe ungefähr fünfzehn Prozent gestrichen) liest sich der Roman flüssiger. Außerdem habe ich einige Fehler korrigiert. Jane Johnson gehört zu den Lektorinnen und Lektoren, die für meinen beruflichen Werdegang besonders wichtig waren; ich bin ihr dankbar, dass sie die Neufassung ermöglicht hat. Bei der Gelegenheit konnte ich auch zwei neue Begriffe einführen. Beide stehen für Phänomene, die im Roman geschildert werden, für die es zum Zeitpunkt des Schreibens aber noch keine Bezeichnung gab: atmosphärischer Fluss und Polarwirbel.
Wenn wir nun all diese verwirrenden Überlegungen zum Genre und zur historischen Entwicklung einmal beiseite lassen – was bleibt übrig? Ein Roman – »eine Prosaerzählung von einer gewissen Länge, mit der etwas nicht stimmt« (Randall Jarrell).
Letztlich also eine Geschichte, die man zum Vergnügen liest. Figuren und Handlung: Das sind die eigentlich wichtigen Dinge in einem Roman. Daher freue ich mich, Ihnen Frank und Marta vorstellen zu dürfen, Charlie und Anna, Joe und Nick, Drepung und Rudra Cakrin, Diane und Phil – Phil, für den John McCain, John Kerry und Franklin Delano Roosevelt Pate standen und der jene US-amerikanischen politischen Führungspersönlichkeiten verkörpert, die unser Land irgendwann wieder leiten werden, wenn der derzeitige Phantast und Todesanbeter abtreten musste. Wenn wir alle wieder der Realität ins Auge blicken und den Kampf um eine lebenswerte Zukunft aufnehmen.
Und dann noch Zeno und Chessman und Fedpage und die anderen Obdachlosen. Diese Menschen habe ich nach realen Vorbildern erschaffen, die ich im Verlauf vieler Jahre beim Frisbee-Golf in einem Park in Davis in Kalifornien kennengelernt habe. Es war mir eine Freude, sie nach Washington zu verpflanzen und in Romanfiguren zu verwandeln und so einen Eindruck von ihrem harten Leben zu vermitteln. Wie ich erfahren habe, sind alle außer Zeno inzwischen gestorben. Obdachlosigkeit endet meistens tödlich: In den USA liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei fünf Jahren, und diese Jahre sind ein einziger harter Kampf. Dass es in den Vereinigten Staaten so viele Obdachlose gibt, ist eines der stärksten Anzeichen dafür, dass unsere Gesellschaft krank ist. Die Person, der ich Zeno nachempfunden habe, ist vor Kurzem nach langer Abwesenheit wieder in unserem Park aufgetaucht. Er hat uns auf die gewohnte Art begrüßt, uns sein neues Glasauge gezeigt, uns erzählt, dass er eine Krebserkrankung überstanden hat, und uns den Tod seiner Freunde mitgeteilt. Menschen sind zu großer Tapferkeit fähig, wenn es Leid und Not auszuhalten gilt, und dieses Durchhaltevermögen, diese Widerstandskraft, diese Solidarität mit den eigenen Freunden zeigt sich bei Zeno und seinen Gefährten mindestens so stark wie bei irgendeiner anderen Figur in diesem Roman.
All diese Leute tragen hoffentlich dazu bei, dass der Roman in unseren schwierigen Zeiten eine stärkende Wirkung entfaltet. Denn letztlich ist er eine Komödie der Problembewältigung und damit ein Beispiel für eine Optopie,also eine Utopie, die aus unserer gegenwärtigen hochgefährlichen Situation das beste überhaupt denkbare Szenario ableitet. Können wir eine bessere Welt erschaffen, können wir das drohende Massenaussterben abwenden? Ja. Das habe ich vor zwanzig Jahren gesagt, und das sage ich auch heute noch.
Ich möchte Fritz Heidorn, Hannes Riffel, Barbara Slawig und allen anderen danken, die an dieser deutschen Ausgabe mitgewirkt haben, einschließlich allen Leserinnen und Lesern.
Also: Vade liber – »Geh, kleines Buch«, wie Chaucer es einmal ausdrückte, ein Zitat, mit dem auch schon Joanna Russ ihre Utopie in die Welt hinausgeschickt hat. »Klein« mag etwas merkwürdig klingen, wenn man bedenkt, dass mich dieses Ungeheuer von einem Buch fünf Jahre meines Lebens gekostet hat, aber am Ende werden Sie hoffentlich verstehen, was ich damit meine: Letztlich kommt es auf die kleinen Dinge im Leben an.
Danke.
Stan
August 2025
© 2025 by Kim Stanley Robinson
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Deutsch von Barbara Slawig
Buchausgabe: Die vierzig Sprachen des Regens (2026)
© der dt. Ausgabe 2025 by Carcosa Verlag, Wittenberge
Redaktion: Hannes Riffel