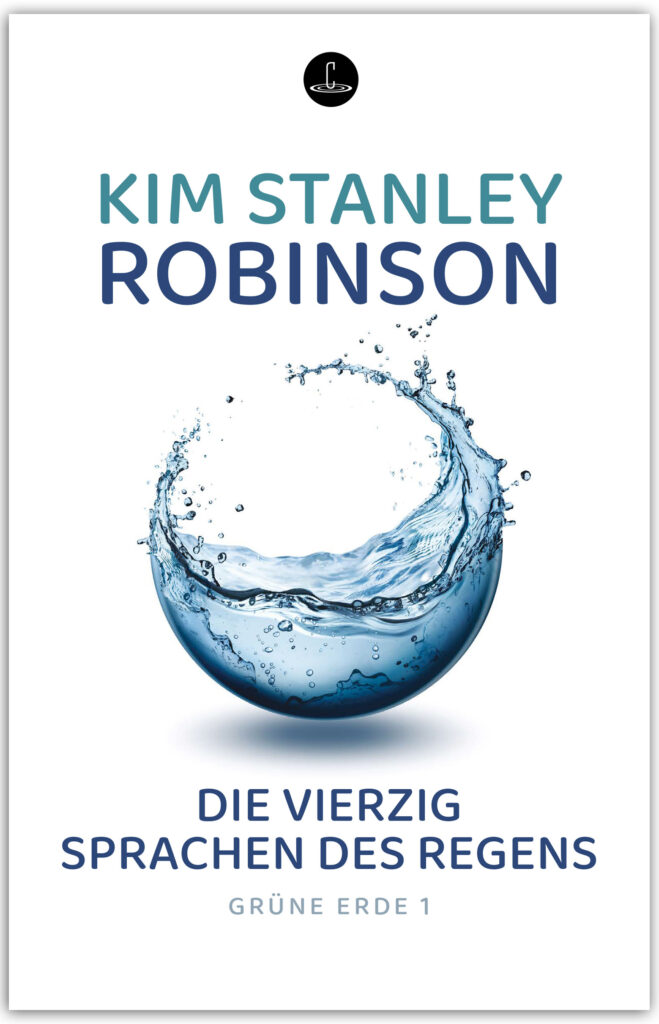von Kim Stanley Robinson
Der 2014 verstorbene Peter Matthiessen war ein großartiger Schriftsteller. Seine Sachbücher sind wundervoll und seine Romane noch besser: Ein Pfeil in den Himmel ist ein echtes Epos, und Far Tortuga ist brillant und ergreifend, einer meiner Lieblingsromane. Wenn man diese Bücher liest, lebt man mehr als nur ein Mal.
Sein dritter großer Roman hat eine ungewöhnliche Veröffentlichungsgeschichte. Er erschien zunächst als Trilogie, die aus den Teilen Killing Mister Watson, Lost Man’s River und Bone by Bone bestand. Ungefähr zehn Jahre später veröffentlichte Matthiessen unter dem Titel Shadow Country eine stark gekürzte Fassung in einem einzigen Band. Als ich dieses Werk in einem Buchladen in die Hand bekam und das Vorwort las, in dem Matthiessen seine Vorgehensweise erklärt, dachte ich augenblicklich: »Genau das möchte ich mit meiner Klimatrilogie auch machen.«
Diese Reaktion überraschte mich selbst. Mir war bis dahin gar nicht bewusst gewesen, dass ich die Romane gern überarbeitet hätte. Normalerweise schaue ich nur selten zurück, wenn ich einen Roman beendet habe, sondern wende mich etwas Neuem zu. Die Arbeit an einem Buch abzuschließen, ist befriedigend, schließlich hat man eine Aufgabe zu Ende gebracht, aber es hat auch etwas Trauriges: Die Figuren hören dann auf, mit mir zu reden. So ähnlich muss sich Calvin fühlen, wenn Hobbes sich in ein Stofftier zurückverwandelt. Eigentlich tragisch, nur dass ich eine einfache Lösung weiß, nämlich einen neuen Roman anzufangen. Und damit geht das Leben weiter.
Im Fall meiner Klimatrilogie – zwischen 2004 und 2007 unter den Titeln Forty Signs of Rain, Fifty Degrees Below und Sixty Days and Counting erschienen – hatte ich jedoch offenbar den Wunsch, weiter am Text herumzubasteln. Nach einigem Nachdenken verstand ich auch wieso. Seit ich mit der Arbeit an dem Projekt begonnen hatte, waren fast fünfzehn Jahre vergangen; in dieser Zeit war der Klimawandel viel stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Inzwischen galt er als das große Problem unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund betrachtet, hatte ich das Gefühl, dass ich in der Trilogie seitenweise Dinge erklärte, die die Leserinnen und Leser längst wussten. Einiges davon konnte man sicher streichen. Die eigentliche Geschichte würde dadurch klarer hervortreten.
Hinzu kam, dass ich beim Schreiben ursprünglich die Idee im Kopf hatte, eine realistische Geschichte mit den Mitteln der Science Fiction zu erzählen. Ich fand das damals witzig, aber auch passend, schließlich ist unser heutiges Leben ein einziger großer Science-Fiction-Roman, den wir alle gemeinsam verfassen. Wer über die Welt von heute schreiben will, sollte das immer in Form von Science Fiction tun, sonst bekommt der Roman unversehens etwas Nostalgisches, es fehlt der Geschichte an Tiefe, sie geht an der Sache vorbei und wirkt verworren.
Die Idee an sich gefiel mir also – sie gefällt mir immer noch –, trug mir aber ein Problem ein, das mir beim Schreiben wohl nicht klar genug war. In der Science Fiction erschafft man bekanntlich fiktive Welten, indem man viele kleine Details einfließen lässt, die den Leserinnen und Lesern helfen, sich Dinge vorzustellen, die es noch nicht gibt. Kuppelstädte unter dem europäischen Eisschild zum Beispiel. Romane, die in der Gegenwart spielen, haben das nicht nötig. Wenn ich die National Mall in Washington erwähne, haben Sie dazu bereits Bilder im Kopf. Ich muss nicht extra beschreiben, wie flach das Wasser im Reflecting Pool oder wie hoch das Washington Monument ist, oder die Steinbrüche benennen, aus denen das Material für den Obelisk stammt. Aber genau an solchen Details habe ich, ehrlich gesagt, meine Freude. Es hat mir Spaß gemacht, Washington so zu beschreiben, als befände die Stadt sich auf einer Umlaufbahn um Aldebaran. Im Nachhinein fand ich jedoch, dass ich es hier und da vielleicht etwas übertrieben hatte. Ein Roman ist wie ein Schiff, er hat seine eigene Freibordmarke, und wenn man ihn zu sehr belädt, kann er bei Sturm kentern. Die Lesenden gehen dann vielleicht lieber schon vorher von Bord oder steigen erst gar nicht ein.
Mit solchen Gedanken im Hinterkopf bin ich den Text durchgegangen und habe überflüssige Details gestrichen, außerdem einige Passagen, die mir unnötig wortreich erschienen (auch die gab es). Matthiessen hat den mittleren Band seiner Trilogie einmal mit dem Hängebauch eines Dackels verglichen. Seine gekürzte Fassung hatte statt 1500 nur noch 900 Seiten; von ihm inspiriert habe ich meine rund 1100 Seiten auf etwa 800 gekürzt. Wichtiges ist dabei nicht verlorengegangen, und meinem Eindruck nach hat die neue Version auch einen besseren Erzählfluss. Vor allem aber: Der Text passt jetzt in einen Band. So erkennt man sofort, dass die drei Teile eigentlich einen einzigen Roman bilden.
Diejenigen, die gern die längere Version der Geschichte lesen möchten, können nach wie vor auf die drei ursprünglichen Romane zurückgreifen. Die Trilogie wurde gelegentlich unter dem Titel The Capital Code gehandelt, meist jedoch unter Science in the Capital, was mir besser gefällt. Beide Bezeichnungen sollen der Originalversion vorbehalten bleiben. Die kürzere Fassung heißt zu meiner Freude nun Green Earth, die deutsche Übersetzung Grüne Erde. So lautete schon eine Kapitelüberschrift in meinem Roman Blauer Mars, und ich hatte immer vor, einmal auch einen Roman so zu nennen; das beschreibt gut, was wir in den kommenden Jahrhunderten erreichen können, wenn es uns gelingt, eine nachhaltig wirtschaftende Zivilisation aufzubauen. Noch haben wir das nicht geschafft; es wird Zeit, dass wir damit anfangen. Dieser Roman beschreibt eine Möglichkeit, wie ein solcher Anfang aussehen könnte.
Diese Geschichte handelt von vielen verschiedenen Dingen: Klimawandel, wissenschaftliche Organisationen und Wissenschaftspolitik, Buddhismus, Biotechnologie und Investitionskapital, Obdachlosigkeit, Soziobiologie, Überwachungsmethoden, das Leben in Washington, das Leben in einem Baumhaus, das Zusammenleben mit einem eigensinnigen Kleinkind. Eine Küchenspüle hat ebenfalls einen Auftritt. Bei so viel Material sollte es niemanden überraschen, wenn in der Geschichte einige Dinge »vorhergesagt« wurden, die später tatsächlich eingetreten sind. Das ist eine Eigenschaft aller Science Fiction, die von der nahen Zukunft handelt.
Trotzdem, manche dieser Pseudovorhersagen haben mich beim Durcharbeiten des Textes durchaus verblüfft. Dass der Sturm, der die Ostküste verwüstet, Sandy heißt, könnte aus J. W. Dunnes Buch über hellseherische Träume An Experiment With Time stammen – mit anderen Worten, es ist einfach ein bemerkenswerter Zufall.
Andere Treffer, insbesondere im Bereich Wetter und Klima, kamen weniger zufällig zustande. Mit der Erderwärmung steigt die Menge an Energie, die in der Atmosphäre gespeichert ist, und extreme Wetterlagen treten häufiger auf. Und da Washington nun einmal tief liegt, steht bei schweren Unwettern regelmäßig die Metro unter Wasser, worauf ich schon zwei oder drei Mal überraschte E‑Mails und sogar Glückwünsche erhalten habe. Vor Kurzem hat das Ingenieurskorps der Armee in aller Stille damit begonnen, quer über der National Mall eine Geländestufe zu errichten, damit zukünftige (unvermeidliche) Überflutungen weniger Schaden anrichten, aber Hurrikan Katrina und das Hochwasser in New Orleans haben nur ein Jahr nach Erscheinen des Romans bewiesen, dass auch Ingenieurskunst nicht immer ausreicht.
Einige der Sundarban-Inseln sind inzwischen unwiderruflich im Meer versunken, so wie es mit Khembalung in Fifty Degrees Below geschieht. Und übrigens, was die minus fünfzig Grad Fahrenheit (-45º Celsius) des Originaltitels angeht: Aufgrund von Verlagerungen des Jetstreams werden arktische Winter immer öfter auch weiter im Süden der nordamerikanischen Ostküste auftreten. Gerade erst hatten wir zwei solche Winter in Folge; während ich dieses Vorwort schreibe, ist es im Norden Virginias kälter als im Norden Alaskas, mit Temperaturen bis zu minus zehn Grad (-22º C). Da erscheint selbst minus fünfzig Grad nicht mehr sehr übertrieben, auch wenn ich zugeben muss, dass die extrem tiefen Temperaturen im Roman der Zahlenfolge in den englischen Romantiteln geschuldet waren. Aber warten wir ab. Atmosphärische Flüsse und Polarwirbel werden wir auf jeden Fall erleben; als ich den Roman schrieb, waren beide Begriffe noch kaum bekannt, aber die Phänomene, die ich in der Geschichte schildere, gab es bereits.
Noch beunruhigender ist, wie sehr die Spionagegeschichte durch die kürzlich aufgedeckten Überwachungsprogramme der National Security Agency bestätigt und sogar überboten wurde. Erste Anzeichen dafür gab es bereits, als ich das Buch geschrieben habe, aber ich dachte, ich würde satirisch übertreiben. Keineswegs. Man interessiert sich für Sie. Ihre Telefonate werden aufgezeichnet, und Computerprogramme stufen ein, welche Gefahr für das System von Ihnen ausgeht. Und Wahlen? Drücken Sie uns die Daumen!
Aus all diesen verschiedenen Gründen wird das Buch wohl noch eine Weile hellseherisch wirken. Es ist zu einer seltsamen Mischung aus historischem Roman, Gegenwartsroman und Science Fiction geworden: Manche Dinge sind schon passiert, andere geschehen gerade, und wieder andere werden sich demnächst ereignen. Einige Dinge wiederum – die Wild Cards in dem Gemisch – werden nie eintreten, denn es ist und bleibt eine fiktive Geschichte. Aber fiktive Geschichten müssen sich nicht bewahrheiten, um ihren Zweck zu erfüllen.
All diese Pseudovorhersagen im Roman gehen letztlich auf meine Beschäftigung mit der Wissenschaft zurück. Sie kann uns Dinge lehren, die für uns als Einzelwesen unsichtbar sind, und auch Romane können von einer solchen Unterstützung durch künstliche Intelligenz nur profitieren. Ja, mit der Wissenschaft besitzen wir bereits jene geniale KI, vor deren Erschaffung wir uns fürchten; sie ist längst aktiv. Hören Sie ihr zu, und handeln Sie entsprechend.
Die Danksagung am Ende des Buchs verrät (für alle drei Bände zusammengefasst), wie viele Menschen mir geholfen haben. Hier möchte ich vor allem betonen, wie viel ich der National Science Foundation verdanke. 1995 war ich im Rahmen ihres Antarctic Writers and Artists Program in der Antarktis, und dieses Erlebnis bildete den Ausgangspunkt für alles, was in diesem Roman erzählt wird. Danach war ich mehrfach im Verwaltungssitz der Stiftung zu Gast, erst um als Jurymitglied an der Auswahl der Künstler für nachfolgende Antarktisaufenthalte mitzuwirken, später dann für Vorträge und Konferenzen. Mehrere Wissenschaftler der NSF haben mir sehr interessant von ihrer Arbeit berichtet, und von der ersten weiblichen Leiterin der Stiftung, Rita Colwell, habe ich manches erfahren, das mir beim Schreiben von Diane Changs Geschichte geholfen hat.
Nachdem der erste Band der ursprünglichen Romanfassung erschienen war, besuchte ich eines Tages wieder einmal das NSF-Gebäude in Arlington, um bei einem der informellen Mittagstreffen einen Vortrag zu halten. Neben den Fahrstühlen hatte Guy Guthridge, mein Ansprechpartner für den Antarktisaufenthalt, Flyer mit der Überschrift NSF RETTET DIE WELT! aufgehängt, und der Vortragssaal war voll. Als Erstes las ich die Szene, in der meine Figuren zu einem Mittagstreffen im NSF-Gebäude zusammenkommen, ihre Lunchpakete öffnen und sich beim Essen einen Vortrag anhören – all den langen Berufsjahren und den vielen Förderanträgen zum Trotz, rein aus Neugier, diesem Impuls, auf dem alle wissenschaftliche Forschung beruht. Während ich die Passage vortrug, hob ich den Kopf, und da saßen sie. Ein Kreis hatte sich geschlossen. Mir wurde fast schwindelig. An diesem Tag haben wir viel gelacht, und auch wenn ich weiß, dass die meisten Leute dort den Gedanken, die NSF könnte die Welt retten, nach wie vor lächerlich finden, eins stimmt auf jeden Fall: Sie haben einen starken Gemeinschaftssinn, sie haben mehr Einfluss, als man ihnen zutrauen würde, und sie leisten gute Arbeit. Ich denke voll Bewunderung und Dankbarkeit an sie; für mich sind sie ein unverzichtbarer Teil eines jeden Staates, in dem das Volk allein durch das Volk zum besten des Volkes herrscht. Wissenschaftler wären durchaus in der Lage, eine größere Rolle bei der Rettung der Welt zu spielen; vielleicht fühlen sich einige von ihnen ja dazu ermuntert, wenn sie eine Geschichte lesen, in der das tatsächlich geschieht. Oder es bringt sie wenigstens zum Lachen. Ein führender Mitarbeiter der NSF soll angeblich sein Haus verkauft haben und in einen Wohnwagen gezogen sein, kaum dass er die Trilogie gelesen hatte. Ganz so weit muss man wohl nicht gehen, aber den Impuls, der dahintersteckt, finde ich gut. Schließlich lesen wir Romane, um ein Gefühl für den Sinn der Welt zu entwickeln, um im Geist das Leben anderer Menschen nachzuvollziehen und auch, um zu lachen. Also lesen Sie weiter – ob Sie nun anschließend in die Wildnis aufbrechen oder nicht –, und lassen Sie sich von der Geschichte ermutigen und unterhalten. Ich danke Ihnen.
© 2015 by Kim Stanley Robinson
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Deutsch von Barbara Slawig
Buchausgabe: Die vierzig Sprachen des Regens (2026)
© der dt. Ausgabe 2025 by Carcosa Verlag, Wittenberge
Redaktion: Hannes Riffel